Hespelers Wahrheit über das jagdliche "Brauchtum"
Jagdliches Brauchtum: Von wem ist es geprägt?
11. Juli 2023

Im Interview: Bruno Hespeler räumt auf mit den Mythen und Märchen rund ums Thema Jagd. Der kritische und streitbare Jagd-Autor und Berufsjäger spricht hier über das jagdliche Brauchtum, woher es kommt und wie es von heutigen Jägern zurechtgebogen wird. Er ist bekannt als jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt.
Bruno Hespeler ist während der ÖJV-Tagung “Verantwortung für den Wald der Zukunft - Was muss Jagd jetzt leisten?” unser Gast im Soonwald und steht an beiden Tagen mit einem Vortrag im Programm.
Entstammt das jagdliche Brauchtum wirklich einer Jahrhunderte alten Tradition. Der Deutsche Jagdverband will es schließlich als Immaterielles Kulturerbe von der UNESCO schützen lassen? Vieles entstand – so wie wir es heute verstehen – erst in jüngerer Zeit, ist also in der heute gepflegten Form nicht wirklich alt. Das hat damit zu tun, dass irgendjemand in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts angeordnet hat, dass ein reichseinheitliches Brauchtum zu erschaffen sei und fortan als “deutsches Kulturgut” gepflegt werden müsse. Darüber müssen wir nicht spekulieren und schon gar nicht streiten; wir können es beim Sammler, Erfinder und Wahrer des jagdlichen Brauchtums, bei Walter Frevert, höchstpersönlich nachlesen. Sein unmissverständlich formulierter Auftrag war es, die bunten, lokal sehr unterschiedlichen Bräuche der Jäger in Sprache und Verhalten, also die tatsächlich gewachsenen Bräuche, zu eliminieren und durch ein einheitliches, neues, aber mit dem Attribut „uralt“ versehenes Brauchtum zu ersetzen.
Vieles entstand – so wie wir es heute verstehen – erst in jüngerer Zeit, ist also in der heute gepflegten Form nicht wirklich alt. Das hat damit zu tun, dass irgendjemand in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts angeordnet hat, dass ein reichseinheitliches Brauchtum zu erschaffen sei und fortan als “deutsches Kulturgut” gepflegt werden müsse. Darüber müssen wir nicht spekulieren und schon gar nicht streiten; wir können es beim Sammler, Erfinder und Wahrer des jagdlichen Brauchtums, bei Walter Frevert, höchstpersönlich nachlesen. Sein unmissverständlich formulierter Auftrag war es, die bunten, lokal sehr unterschiedlichen Bräuche der Jäger in Sprache und Verhalten, also die tatsächlich gewachsenen Bräuche, zu eliminieren und durch ein einheitliches, neues, aber mit dem Attribut „uralt“ versehenes Brauchtum zu ersetzen.
Ist das ein rein deutsches Phänomen?
Inzwischen haben auch andere europäische Völker dieses „uralte Kulturgut des deutschen Volkes“ (Zitat aus Frevert „Das jagdliche Brauchtum“) für sich entdeckt. So veranstalten beispielsweise auch Italiens Jäger Bläserwettbewerbe und bauen sich dazu im Bayernlook auf. Es gibt in Berlusconis Gauen sogar Jagdvereine, deren Mitglieder sich mit Weidmannsheil grüßen, auch wenn sie sonst außer Merkel und Berlin keine weiteren Worte deutsch sprechen.
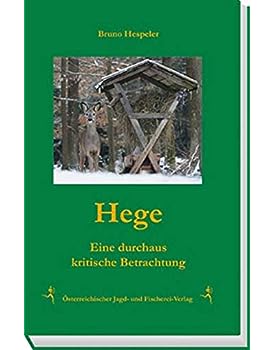
Buchtipp: “Hege - Eine durchaus kritische Betrachtung Bruno Hespeler”
Man hat im Lauf der Geschichte alles Mögliche unter „Hege“ verstanden: zum Beispiel Raubwild bejagen, Raubzeug bekämpfen, Wildtiere füttern, Salz vorlegen, „Blut auffrischen“, Exoten aussetzen, durch Wahlabschuss Wildbestände „verbessern“ oder Wild „aufarten“. Man gab vor, damit dem Wohlergehen der Tiere zu dienen. Nur: Dem Wild hat die Hege durch den Jäger oft genug nicht gedient.
304 Seiten, rund 60 Farbbilder. (Österreichischer Jagd- und Fischereiverlag, 39 Euro)
Thema Jagdhorn und Jagdsignale. Das ist doch eine schöne UND nützliche Tradition, oder?
Jagdhornblasen ist eine schöne Sache, die wir pflegen sollten. Aber es ist geradezu lächerlich so zu tun, als seien die gängigen Leit- und Totsignale seit Jahrhunderten überliefert und gepflegt worden. Mitnichten. Das Verblasen der Strecke war weithin unbekannt oder zumindest unüblich. Die Totsignale wurden weitgehend im 20. Jahrhundert komponiert, manche sogar erst in der zweiten Hälfte, also sozusagen in jüngster Zeit. Die Leitsignale hatten nur bei den wirklich großen Niederwildjagden Bedeutung. Dort waren sie nicht nur brauchbar, sondern sogar notwendig. Aber es wurden keineswegs einheitliche Signale verwendet. Vielmehr bediente man sich in den zerstrittenen und sich bis Ende des 19. Jahrhunderts militärisch attackierenden deutschsprachigen Ländern (Stichwort: „einig deutsches Vaterland“) in der Regel der jeweils geltenden militärischen Schlachtsignale. Beispiel: „Linker Flügel vor“ oder „Das Ganze Halt“. Erst Frevert vereinheitlichte die Signale, ließ neue „erfinden“ und legte eine jagdliche Liturgie fest. Ein erheblicher Teil der heute gebräuchlichen Signale entstammt der Feder Professor Clevings.
Nicht nur die den Schlachtordnungen entlehnten und für große Niederwildjagden adaptierten militärischen Leitsignale, auch andere Jagdsignale waren in alter Zeit durchaus brauchbar und wichtig. Erinnert sei nur an den „Wagenruf“. Das hat sich geändert. Heute flüstern auch die Brauchtums-Hartliner lieber mit dem Handy nach dem nächsten Allrad als mit dem Horn nach dem Pferdewagen.
In meiner Wahlheimat Kärnten, wo inzwischen das Jagdhornblasen von zahlreichen Bläsergruppen gepflegt wird, tauchte das erste Plesshorn Mitte der 60er-Jahre auf. Graf Thun-Valsassina hat es von einer Reise (vermutlich aus Deutschland) mitgebracht und seinem Personal zur Verwendung empfohlen. Dieses und überhaupt die heimische Jägerei standen der Verwendung der „Jagdtrompeten“ zunächst eher ablehnend gegenüber. Übrigens ein Zeichen, dass das Jagdhornblasen zumindest in weiten Teilen von „Führers Heimat“, trotz deren auch jagdlich vollzogener „Rückkehr in das Deutsche Reich“ weitgehend unbekannt war.
Aber das Jagdhorn ist doch in seiner heutigen Form aus dem Bild der Jagd kaum wegzudenken.
In den einzelnen Ländern wurden nicht nur völlig unterschiedliche Signale geblasen. Auch die Hörner waren keineswegs einheitlich. Das sicher am wenigsten geschichtsträchtige Horn ist das Fürst-Pless-Horn. Sein Name nennt den „Erfinder“. Es war Fürst Pless, der die vermutlich am preisgünstigsten zu erwerbenden Posthörner mit einer grünen Lederfessel ausstatten und an sein Forstpersonal verteilen ließ. Als die Preußen das Königreich Niedersachsen niedermachten, verboten sie spontan den Gebrauch der alten hannoverschen Jagdhörner.
Trotzdem: In Hubertus-Messen sind Hörner durchaus stimmungsvoll.
Heute feiern wir – eine durchaus begrüßenswerte Sache – Hubertusmessen. Auch sie werden gerne als uralt bezeichnet, sind es aber nicht. Im Gegenteil, in Deutschland wurde die erste Hubertusmesse 1965 von Reinhold Stief in Heidelberg organisiert und geblasen. Alt, wirklich alt ist hingegen die Jägermesse. Während die heutigen Hubertusmessen nicht unbedingt gebraucht werden (man könnte ja problemlos jeden Sonntag die Heilige Messe besuchen), wurde die Jägermesse alter Ordnung tatsächlich gebraucht. Jägermessen wurden nämlich in Zeiten gefeiert als es noch Kopf und Kragen kosten konnte, der Kirche notorisch fernzubleiben. Daher hat sich zumindest bei einem Teil der damaligen Standesherrschaften die Gewohnheit etabliert, an Jagdtagen, statt der doch etwas zeitaufwändigen Heiligen Messe, eine kurze Jägermesse lesen zu lassen. Diese Gepflogenheit dürfte auch all jenen geistlichen Herrn entgegen gekommen sein, die selbst gerne dem Weidwerk frönten. Die Jägermesse war kurz und bündig, ohne allzu viel Orgel und Chor, eben gerade so weit ausgestattet, dass der Christenpflicht Genüge getan wurde. Der Brauch war absolut brauchbar!
Ein wichtiges Lernthema in Jägerprüfungen sind Bruchzeichen. Was hat es damit auf sich?
Dazu ein kleines Beispiel: Wir erlegen ein Stück Rotwild, ziehen das Handy aus der Tasche und rufen einen Helfer. Im November 1707 lief das ganz anders. Der Förster, der einen Hirsch geschossen hatte, lief brav drei Stunden ins Dorf, trank daheim einen doppelten Korn und schickte seinen Lehrling zum nächsten Holzhacker, damit die beiden den Hirsch mit dem Gespann einholten. Er konnte sie weder telefonisch rufen noch einweisen. Aber dafür hatte er eventuell draußen auch ein paar Brüche gesteckt und gelegt. Natürlich hat er nur „betriebseigene“ und wahrscheinlich öfters ihre Bedeutung wechselnde Bruchzeichen verwendet. Ansonsten hätte ja jeder zufällig im Wald herumstreunende Gauner die genormten, sozusagen reichseinheitlichen Bruchzeichen „abhören“ können.
Publik gemacht oder gar irgendwo veröffentlicht wurden die Bruchzeichen sicher nicht, jedenfalls nicht die, die draußen tatsächlich verwendet wurden. Allenfalls musste sie der betriebseigene Jagdlehrling – höchst intern und diskret – bei der Prüfung herunterplappern. Seit die Zeichen weitgehend ihre Bedeutung verloren haben, muss sie der Jungjäger aber sehr wohl peinlich kennen. So wurde aus dereinst Brauchbarem Brauchtum!
Inzwischen drückt man uns bei der Stöberjagd einen halben Meter Textilband in die Hand, mit dem wir allfällig Anschüsse zu markieren haben. Wie ein beschossenes Stück gezeichnet hat, wohin es absprang oder wo das bereits aufgebrochene Stück liegt, das teilen wir – so wie wohl auch früher schon – am besten mündlich mit.
Übrigens war es noch vor 20 Jahren fast unmöglich, mit etwas anderem als dem traditionellen ledernen Schweißriemen bei einer Prüfung anzutreten. Zumindest in der Praxis haben sich inzwischen stabile, pflegeleichte und preisgünstige Schweißriemen aus anderen Materialien durchgesetzt. Wer darin einen Verstoß gegen die Pflege des Brauchtums sieht sollte ernsthaft darüber nachdenken, zu was die Alten gegriffen hätten, hätten es zu ihrer Zeit die heutigen Materialien bereits gegeben?
Ein anderes Beispiel ist der „Warnbruch“, der vor einem Eisen warnen soll. Sicher war auch früher sein Aussehen nicht genormt und sicher nicht allgemein bekannt. Fangeisen kosteten Geld und kein Förster hatte Interesse daran, dass ihm die Dinger Dank allgemeinverständlicher Markierung gestohlen wurden. Jenen aber, die sich befugt im Wald aufhielten oder gar die Eisen kontrollieren sollten, wird er schon etwas genauer beschrieben haben, wo sie liegen. Wenn er dann am Fangplatz noch zusätzlich einen Hinweis anbrachte, dann sicher nicht in Form eines reichseinheitlich genormten Warnbruchs, zumal das, was wir heute unter „Deutschland“ verstehen, erst 1848 unter weiteren kriegerischen Vorbehalten entstand.
Gibt es auch Beispiele für Brauchtum, das heute noch Nutzen bringt
Ja, es gibt Brauchtum, das wirklich alt ist und im jagdlichen Alltag einmal unverzichtbar war. Denken wir nur an die liebe und vor Jahren schon aufgegebene Gewohnheit, im Frühjahr keinen grauen Rehbock zu schießen. Was auch hätte man mit dem toten Bock machen sollen, als es noch keinen Allrad mit Wildwanne gab und Wasser als Reinigungsmittel verschmutzten Wildbrets auch noch nicht sonderlich im Kurs stand? Wer jetzt nicht versteht, um was es geht, der stopfe einen grauen, in der Härung befindlichen Maibock in seinen Rucksack und trage ihn eine Stunde spazieren, um ihn anschließend zu zerwirken. Am Wildbret wird er anschließend wenig Freude haben! Wie anders der rote Sommerbock im jungen stabilen Haar. Den durfte man getrost in den „Achselallrad“, sprich Rucksack stopfen, heim tragen und anschließend ohne übermäßige Hygieneprobleme verwerten.
Ein anderer alter Brauch ist der der Totenwacht. Inzwischen ist sie etwas in Vergessenheit geraten, weil wir nach der Jagd die Tagesthemen nicht versäumen wollen. Aber vor noch nicht allzu langer Zeit hackten die Prüfer noch darauf herum, und wir mussten ihnen irgendeinen rührseligen Kram über die Ehrung des toten Wildes erzählen (welches wir höchst ungern ins Jenseits befördert haben) oder darüber, dass wir stumme Zwiesprache halten, dass wir in der halben Stunde der Totenwacht noch einmal das ganze jagdliche Geschehen vor unserem inneren Auge ablaufen lassen. In Wirklichkeit musste das Wild vor dem Abtransport gründlich ausschweißen und der Schweiß (Blut) musste abtrocknen, damit nicht die gesamte Klamottage versaut war!
Dass wir heute zwar graue, abgemagerte Maiböcke erlegen, feiste Novemberböcke aber unter Schutz stellen, ist zwar nicht nachvollzieh- aber verkraftbar. Nachvollziehbar ist hingegen, dass unsere Vorfahren die Rehe – auch die Böcke – viel lieber in den kalten Spätherbst- oder Frühwinterwochen schossen als an schwülen Sommerabenden. Das war schlicht pragmatisch, denn wie sollte man als „Otto-Normaljäger“ das Wildbret kühlen? Im Sommer durfte nur erlegt werden, was sich auch unverzüglich verbrauchen ließ. Wir sehen also, vieles hatte einmal seinen Sinn, manches war unverzichtbar. Was nicht mehr brauchbar aber dennoch schön ist dürfen wir getrost erhalten, wenn es sinnvoll ist auch weiterentwickeln.
